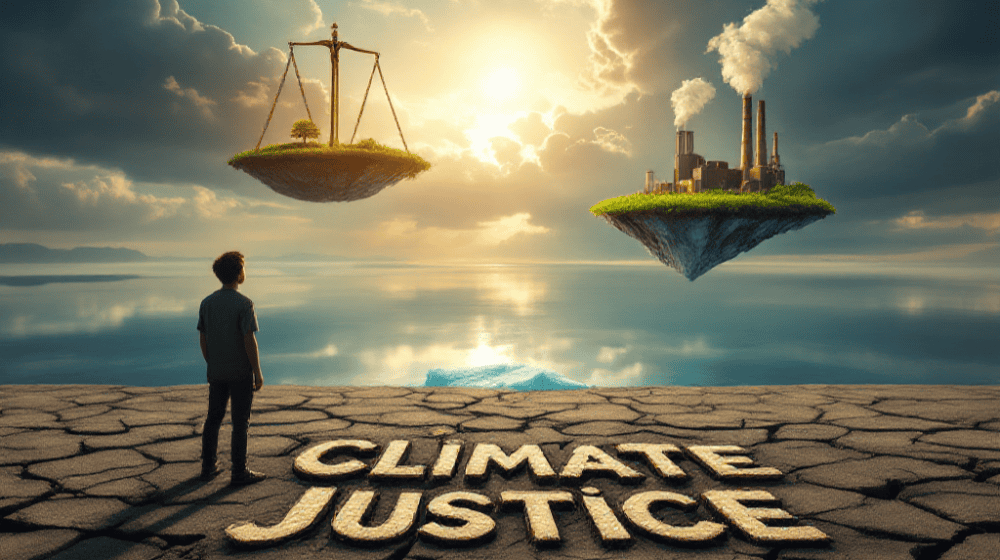Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat gesprochen. Und obwohl sein neues Gutachten vom 23. Juli 2025 nur beratend ist, klingt es wie eine juristische Klatsche mit der Wucht eines globalen Fönsturms. Staaten dieser Welt, so die Richter, stehen völkerrechtlich in der Pflicht, das Klima zu schützen – nicht als nette Nebenaufgabe, sondern als existenzielles Muss.
Worum geht’s?
Die UN-Generalversammlung hatte das höchste Gericht der Welt 2023 gebeten, zwei Fragen zu klären:
- Welche rechtlichen Verpflichtungen haben Staaten, um den menschengemachten Klimawandel zu stoppen – auch für zukünftige Generationen?
- Welche juristischen Konsequenzen drohen, wenn Staaten diese Verpflichtungen verletzen?
Antwort: Eine Menge.
Die Kernaussagen – juristisch, aber deutlich
- Klimaschutz ist Völkerrecht: Der IGH erkennt an, dass Staaten auf Basis des Völkerrechts verpflichtet sind, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Schäden durch Treibhausgase zu verhindern. Das ist keine Moralpredigt, sondern geltendes Recht – basierend auf UN-Klimaverträgen, Menschenrechten und Gewohnheitsrecht.
- Sorgfaltspflicht mit Nachdruck: Staaten müssen laut Gericht mit „strenger Sorgfalt“ handeln. Wer einfach weiter CO₂ rausballert und keine ernsthaften Maßnahmen trifft, verstößt gegen das Völkerrecht – ganz gleich ob aktiv oder durch Unterlassen.
- Gerechtigkeit zählt: Das Gutachten betont „intergenerationelle Gerechtigkeit“. Staaten schulden nicht nur ihren Bürgern heute, sondern auch jenen, die noch gar nicht geboren wurden, einen lebenswerten Planeten.
- Pflicht zur Kooperation: Das Gericht verpflichtet Staaten zur internationalen Zusammenarbeit – insbesondere bei Technologie, Finanzen und dem Aufbau von Anpassungsfähigkeit in betroffenen Ländern. Und zwar nicht „wenn’s passt“, sondern verbindlich.
Was bedeutet das für Deutschland?
Das Gutachten ist ein Weckruf – auch für die Bundesregierung. Zwar ist das Urteil formal nicht bindend. Doch für deutsche Gerichte, Klimaklagen und politische Strategien könnte es zur neuen juristischen Grundlage werden.
Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2021 klargemacht, dass Klimaschutz Verfassungsrang hat. Jetzt kommt die höchste völkerrechtliche Instanz dazu und gibt dem Ganzen eine globale Dimension.
Kleine Inseln, große Wirkung
Dass dieser Richterspruch überhaupt zustande kam, verdanken wir nicht den „großen Playern“, sondern einer Allianz von kleinen Inselstaaten wie Vanuatu, Tuvalu oder den Marshallinseln. Staaten, die vom steigenden Meeresspiegel konkret bedroht sind – und deren junge Jurist:innen und Aktivist:innen sich nicht länger vertrösten lassen wollten.
Sie haben nicht nur gekämpft, sondern gewonnen: für mehr Klarheit, mehr Gerechtigkeit und mehr Druck auf die Emissionsverantwortlichen.
Und was jetzt?
Klimaklagen werden zunehmen. Die „Berufung auf höhere Gewalt“ à la Wirtschaftswachstum oder Realpolitik zieht nicht mehr. Staaten können künftig vor Gericht gestellt werden – nicht nur moralisch, sondern auch völkerrechtlich haftbar.
Ob das den Klimawandel stoppt? Nein.
Aber es verschiebt die Deutungshoheit: Wer das Klima weiter verheizt, steht juristisch nicht mehr auf der sicheren Seite. Und wer handelt, handelt nicht nur politisch klug, sondern rechtlich geboten.
Fazit – Die Erde vor Gericht
Der IGH hat der Welt kein Urteil gefällt – aber ein Rechtsfundament gelegt, auf dem neue Gerechtigkeit wachsen kann. In Zeiten globaler Hitze, brennender Wälder und schmelzender Küsten ist das mehr als Symbolik.
Es ist ein juristisches Thermometer – und es zeigt: Die Erde kocht. Zeit, sie nicht weiter zu verbrühen.
Quelle: https://www.icj-cij.org